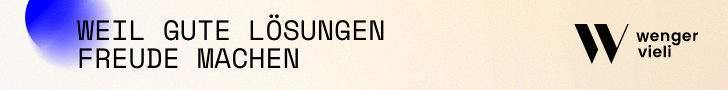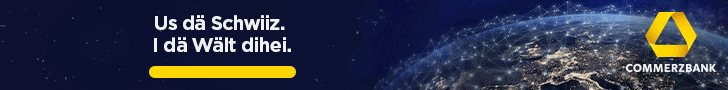Dieser Artikel beleuchtet die rechtlichen Herausforderungen und Wege, die zur Durchführung von Umwandlungen zwischen deutschen und schweizerischen Gesellschaften führen können.
Status Quo nach dem UmRUG
Mit dem UmRUG ist es dem deutschen Gesetzgeber gelungen, die EU-Umwandlungsrichtlinie in das deutsche Recht zu implementieren. Bedeutend ist die Neuregelung im sechsten Buch des Umwandlungsgesetzes, welches die Neubezeichnung «grenzüberschreitende Umwandlung» trägt. Es ermöglicht nun eindeutig grenzüberschreitende Verschmelzungen, Spaltungen und Formwechsel zwischen Kapitalgesellschaften innerhalb der EU und des EWR nicht aber von Drittstaaten.
Nach § 306 UmwG sind ausschliesslich Kapitalgesellschaften berechtigt, an einer grenzüberschreitenden Verschmelzung teilzunehmen, die nach dem Recht eines Mitgliedstaats der EU oder des EWR gegründet worden sind und ihren satzungsmässigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung in einem Mitgliedstaat der EU oder des EWR haben. Genauso wird dies in § 321 UmwG für eine grenzübergreifende Spaltung festgelegt und in § 334 UmwG für den grenzübergreifenden Formwechsel.
Diese Regelungen stehen im Zeichen der Niederlassungsfreiheit, welche zu den Grundprinzipien des Unionsrechts gehört. Nach Auslegung des Gerichtshofs der Europäischen Union umfasst die Niederlassungsfreiheit den Anspruch einer jeden nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründeten Gesellschaft auf Umwandlung in eine dem Recht eines anderen Mitgliedstaats unterliegende Gesellschaft.
Kurz gesagt bedeutet dies jedoch, dass Gesellschaften aus Drittstaaten, wie der Schweiz, nicht von dem Anwendungsbereich des UmwG erfasst werden.
Bestehende Lösungsmöglichkeiten
Umwandlungen zwischen deutschen und schweizerischen Unternehmen sind theoretisch möglich, wenn auch auf Umwegen. Es existieren EU-Mitgliedstaaten, die flexiblere Regelungen für Unternehmensumwandlungen mit Drittstaaten geschaffen haben als Deutschland. Dazu zählen insbesondere Österreich und Luxemburg. Vor diesem Hintergrund besteht die Möglichkeit von Umwandlungsvorgängen mit Schweizer Gesellschaften über den Umweg durch EU-/EWR-Staaten.
1. Schweizer Gesellschaft nach Deutschland
Zunächst kann die Drittstaatengesellschaft zuerst in einen EU- oder EWR-Staat wechseln, der grenzüberschreitende Umwandlungen mit Drittstaaten zulässt, bevor eine weitere Umwandlung nach Deutschland durchgeführt wird.
2. Deutsche Gesellschaft in die Schweiz
Andersherum kann genauso die deutsche Gesellschaft in einen EU- oder EWR-Staat wechseln, der grenzüberschreitende Umwandlungen mit Drittstaaten zulässt, bevor eine weitere Umwandlung in die Schweiz stattfindet.
3. Problematischer Formwechsel
In dieser Praxis besteht eine problematische Konstellation: Eine schweizerische Gesellschaft wird durch einen grenzüberschreitenden Formwechsel in einen EU-/EWR-Staat übertragen. Nach erfolgtem Formwechsel könnte diese Gesellschaft dann an einer Umwandlungsmassnahme mit einer deutschen Gesellschaft teilnehmen. Dies ist problematisch, da unklar ist, ob ein solcher Formwechsel im Zuzugsstaat als „Neugründung“ im Sinne des UmwG angesehen wird, was eine Voraussetzung für die Teilnahme an grenzüberschreitenden Umwandlungen darstellt, indem die beteiligten Gesellschaften nach dem Recht eines Mitgliedsstaats gegründet sein müssen. Dies könnte verneint werden, indem der Formwechsel die rechtliche Identität unberührt lässt und bisherige Anteilseigner beibehalten werden.
Bis diese Frage höchstrichterlich geklärt wird, wird in der Praxis jedoch empfohlen, stattdessen den Weg über eine vorgeschaltete Verschmelzung zu wählen, um Rechtsunsicherheiten zu vermeiden.
Steuerliche Regelungen
Etwas offener hat es der Gesetzgeber im Steuerrecht gehalten: Das Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts aus dem Jahr 2021, hatte laut des Bundesfinanzministeriums zum Ziel, dass künftig neben Verschmelzungen auch Spaltungen und Formwechsel von Körperschaften mit Bezug zu Drittstaaten steuerneutral möglich sein sollten. Wodurch die Möglichkeiten für deutsche Unternehmen und ihre ausländischen Tochtergesellschaften massgeblich erweitert würden, betrieblich sinnvolle Umstrukturierungsmassnahmen steuerneutral durchzuführen.
Ab dem 1.1.2022 wurde der § 1 Abs. 2 UmwStG gestrichen, welcher den persönlichen Anwendungsbereich des § 1 Abs. 1 UmwStG definierte. Nun besteht für den übernehmenden, übertragenden sowie einen durch Formwechsel umwandelnden Rechtsträgers nach § 1 Abs. 1 UmStG nicht mehr das Erfordernis der Ansässigkeit in der EU oder dem EWR.
Fazit und Ausblick
Das UmRUG hat grenzüberschreitende Umwandlungen innerhalb der EU und des EWR erheblich erleichtert, schliesst jedoch Drittstaaten explizit aus. Für deutsche Unternehmen, die grenzüberschreitende Umwandlungen mit Drittstaaten wie der Schweiz anstreben, bieten sich dennoch Möglichkeiten – wenn auch über Umwege. Durch den Umweg über EU-/EWR-Mitgliedsstaaten, die Drittstaatenumwandlungen zulassen, können grenzüberschreitende Unternehmensumwandlungen in der Theorie erfolgreich durchgeführt werden. Die einfachste (und wohl auch kostengünstigste) Möglichkeit bleibt die Neugründung einer Niederlassung in der Schweiz. Je nachdem, was die Bedürfnisse des deutschen Unternehmens sind, bieten sich hier verschiedene Möglichkeiten an. Die Handelskammer Deutschland – Schweiz ist ausgezeichnet vernetzt und bietet einen full-service zur Gründung an. Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.