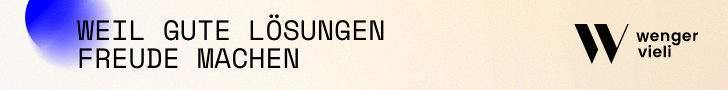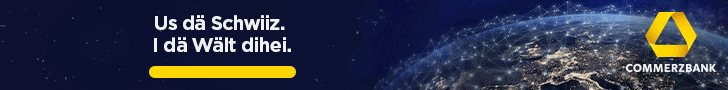Als indirekten Gegenvorschlag zur Fair-Preis-Initiative hat das Parlament die kartellrechtliche Missbrauchskontrolle gemäss Art. 7 des Kartellgesetzes («KG»), welche vorher nur gegenüber marktbeherrschenden Unternehmen galt, auf relativ marktmächtige Unternehmen ausgeweitet. Als relativ marktmächtig gilt ein Unternehmen, von dem andere Unternehmen beim Angebot oder bei der Nachfrage einer Ware oder Leistung in einer Weise abhängig sind, dass keine ausreichenden und zumutbaren Ausweichmöglichkeiten bestehen (Art. 4 Abs. 2bis KG). Anders als bei der Marktbeherrschung, bei welcher auf die Marktstellung des marktbeherrschenden Unternehmens gegenüber sämtlichen anderen Marktteilnehmern abgestellt wird (erga omnes), ist bei der relativen Marktmacht die konkrete Geschäftsbeziehung unabhängig von der allgemeinen Marktstellung entscheidend (inter partes). Der Anwendungsbereich der kartellrechtlichen Missbrauchskontrolle wurde dadurch erheblich erweitert. Die Neuerung eröffnet abhängigen Unternehmen neue Rechte und auferlegt relativ marktmächtigen Unternehmen zusätzliche Pflichten.
Mögliche Folgen eines Missbrauchs einer relativen Marktmacht
Bussen gegenüber relativ marktmächtigen Unternehmen werden nur verhängt, wenn das relativ marktmächtige Unternehmen gegen eine rechtskräftige Verfügung der WEKO verstösst. Trotzdem verdient die Neuerung Aufmerksamkeit: Bereits der Aufwand eines Kartellverfahrens an sich ist beträchtlich, und Vertragspartner können unter Umständen zivilrechtlich Schadenersatz fordern. Ein negativer Entscheid der WEKO oder eines Gerichts kann zudem die Handlungsfreiheit von Unternehmen erheblich einschränken.
Schweizer Vertriebsgesellschaften ausländischer Unternehmen besonders betroffen
Sämtliche kartellrechtlichen Missbrauchstatbestände, welche für marktbeherrschende Unternehmen gelten, gelten neu auch für relativ marktmächtige Unternehmen. Dazu gehören unter anderem die Verweigerung von Geschäftsbeziehungen, die Diskriminierung von Handelspartnern, die Erzwingung unangemessener Preise oder sonstiger unangemessener Geschäftsbeziehungen, Angebotseinschränkungen oder die Bündelung von Leistungen (Art. 7 Abs. 2 Bst. a bis f KG). Zusätzlich hat der Gesetzgeber mit Art. 7 Abs. 2 Bst. g KG ein Direktbezugsrecht im Ausland geschaffen. Gemäss dieser Bestimmung fällt die Einschränkung der Möglichkeit von Nachfragern in der Schweiz, Waren oder Leistungen, die in der Schweiz und im Ausland angeboten werden, im Ausland zu den dortigen Marktpreisen und den dortigen branchenüblichen Bedingungen zu beziehen, als missbräuchliche Verhaltensweise in Betracht. Dieses Direktbezugsrecht im Ausland ist ein zentraler Punkt der Gesetzesreform, welche durch eine Senkung der Beschaffungskosten beim Import die hohen «Schweizer Preise» bekämpfen sollte. So zeigen auch unsere Erfahrungen in der Beratung und die bisher eröffneten Untersuchungen: Von den neuen Bestimmungen sind vor allem ausländische Konzerne mit einer eigenen Vertriebsstruktur in der Schweiz betroffen.
Erkenntnisse aus dem ersten Entscheid der WEKO
Der nun vorliegende erste Entscheid der WEKO zur relativen Marktmacht betrifft das Direktbezugsrecht im Ausland. In einer Anzeige an die WEKO warf die Schweizer Galexis AG (Galexis) der deutschen Fresenius Kabi-Gruppe (Fresenius Kabi) vor, sich zu weigern, die Galexis in Deutschland und den Niederlanden mit Trink- und Sondennahrung und entsprechenden Hilfsmitteln zu beliefern. Die Prüfung der WEKO erfolgt in zwei Schritten:
Erster Schritt: Liegt eine relative Marktmacht vor?
Die WEKO prüft anhand der folgenden Kriterien, ob eine relative Marktmacht vorliegt:
1. Abhängigkeit: Hat das betroffene Unternehmen ausreichende und zumutbare Ausweichmöglichkeiten? Als mögliche Gründe für eine Abhängigkeit nennt das Merkblatt der WEKO zur relativen Marktmacht beispielhaft u.a. einen Mangel an alternativen Nachfragern oder die Ausrichtung eines Betriebs auf eine längerfristige Geschäftsbeziehung. Die Abhängigkeit prüft die WEKO in drei Schritten:
a) Ermittlung der Ausweichmöglichkeiten (Sachverhaltsfrage). Eine mögliche Form des Ausweichens ist auch der Verzicht auf die Leistung.
b) Feststellung der allfälligen Folgen des Ausweichens (Sachverhaltsfrage). Massgebend ist insbesondere, welche Folgen das Ausweichen für das mutmasslich abhängige Unternehmen hätte, d.h. ob es eine Umsatzeinbusse, höhere Aufwendungen oder insbesondere einen tieferen Gewinn zur Folge hätte.
c) Beurteilung der Zumutbarkeit der Folgen (Rechtsfrage). Nicht jeder Nachteil ist unzumutbar. Dass die Alternativen einen gleichwertigen Ersatz bieten müssen, ist der Bestimmung nicht zu entnehmen. Die Beurteilung der Zumutbarkeit der Folgen hängt von den Auswirkungen der Nachteile für das konkret betroffene Unternehmen ab.
2. Mangelnde Gegenmacht des abhängigen Unternehmens: Besteht zwischen den Unternehmen in Bezug auf das fragliche Geschäft eine ungleiche Machtverteilung?
3. Grobes Selbstverschulden: Ist die Abhängigkeit auf eigene Fehler des abhängigen Unternehmens zurückzuführen?
Zweiter Schritt: Wird eine relative Marktmacht missbraucht?
Soweit ein Unternehmen relative Marktmacht hat, prüft die WEKO, ob es sich missbräuchlich verhält. Dies wäre der Fall, wenn es ein anderes Unternehmen im Wettbewerb behindert oder benachteiligt und wenn es dafür keine wirtschaftlichen Rechtfertigungsgründe gibt.
Fehlende Relative Marktmacht von Fresenius Kabi
Die WEKO prüfte im vorliegenden Fall wie folgt, ob die Galexis von Fresenius Kabi abhängig ist:
a) Ausweichmöglichkeiten: Für die Galexis besteht nach Ansicht der WEKO die vorteilhafteste Ausweichmöglichkeit darin, möglichst viele Kunden zum Umsteigen auf vergleichbare Trinknahrung anderer Hersteller zu bewegen und ansonsten diese Produkte nicht mehr anzubieten.
b) Folgen des Ausweichens: Die WEKO schloss, dass die Galexis durch die Auflösung der Lieferbeziehung zu Fresenius Kabi gewisse Umsatzeinbussen erleiden würde. Zudem gäbe es weitere Nachteile, wie insbesondere Einbussen bei der Attraktivität der Galexis als Grossistin infolge des Wegfalls der Trinknahrung von Fresenius Kabi aus ihrem Sortiment. Diese Einbussen dürften gemäss der WEKO aber eher gering ausfallen.
c) Zumutbarkeit der Folgen: Gemessen an der Finanzkraft der Galenica-Gruppe, zu welcher die Galexis gehört, wären die durch den (hypothetischen) Wegfall der Lieferbeziehung zu Fresenius Kabi entstehenden Nachteile gering und damit zumutbar.
Die WEKO gelangte damit zum Schluss:
1. Die Galexis ist nicht von Fresenius Kabi abhängig.
2. Genügend Gegenmacht. Es besteht kein klares Ungleichgewicht der Nachteile für die beiden Unternehmen bei einer (hypothetischen) Auflösung der Lieferbeziehung.
3. Die Frage des groben Selbstverschuldens erübrigt sich. Die WEKO entschied entsprechend, dass Fresenius Kabi in Bezug auf Trink- und Sondennahrung und entsprechende Hilfsmittel gegenüber der Galexis keine relative Marktmacht hat. Ohne relative Marktmacht scheidet ein Verstoss gegen die Bestimmungen zur relativen Marktmacht aus.
Eventualbegründung: Fehlender Missbrauch durch Fresenius Kabi
Selbst wenn Fresenius Kabi gegenüber der Galexis relative Marktmacht hätte, wäre die Verweigerung der Belieferung im Ausland durch Fresenius Kabi im vorliegenden Fall nicht missbräuchlich. Es kann nicht nachgewiesen werden, dass die ausländischen Konditionen mehr als geringfügig besser sind als die Bedingungen der Galexis beim Einkauf in der Schweiz bei Fresenius Kabi Schweiz. Die WEKO hat damit klargestellt, dass die Verweigerung der Belieferung im Ausland nur missbräuchlich ist, wenn das vom relativ marktmächtigen Unternehmen abhängige Unternehmen aufgrund von schlechteren Konditionen benachteiligt oder ausgebeutet wird. Insbesondere Unterschiede von individuell verhandelten Preisen sind schwierig festzustellen. Unterschiedliche, sich laufend verändernde Faktoren beeinflussen diese. Auch das Verhandlungsgeschick spielt eine Rolle. Bei internationalen Preisvergleichen gibt es zudem Schwankungen bei Wechselkursen. Um sich nicht der Gefahr der Illegalität auszusetzen, müsste ein Unternehmen seinen potenziell abhängigen Abnehmern in der Schweiz im Sinne einer Sicherheitsmarge substanziell bessere Konditionen gewähren als Abnehmern im Ausland. Das kann nicht Sinn und Zweck der Bestimmungen zur relativen Marktmacht sein. Geringfügige Preisunterschiede müssen möglich sein. Aufgrund der unterschiedlichen Faktoren gibt es nicht den einen Preis. Ausgehend vom jeweiligen konkreten Geschäftsmodell ist das Vorliegen einer relativen Marktmacht und eines allfälligen Missbrauchs in jedem Einzelfall gesondert zu prüfen.
Hinweis
Der guten Ordnung halber ist offenzulegen, dass Niederer Kraft Frey Fresenius Kabi in diesem Verfahren vertreten hat.
Mögliche Massnahmen zur Risikominimierung:
– Vor Verhandlungen: Prüfung von Geschäftsbeziehungen auf mögliche Abhängigkeit. Abgesehen von klaren Fällen dürfte eine solche Analyse mangels genauer Kenntnisse der Verhältnisse beim Geschäftspartner allerdings teilweise schwierig sein.
– Falls mutmasslich eine relative Marktmacht besteht:
o Analyse der Preise und branchenüblichen Bedingungen im Ausland und entsprechend Abstimmen des Angebots in der Schweiz. Berücksichtigen der Faktoren gemäss Praxis der WEKO. Auf diese Weise berechnete Angebote sind u.U. nicht nachteilig.
o Gegebenenfalls Vorbringen von wirtschaftlichen Rechtfertigungsgründen.
o Angemessene Übergangs- und Umstellungsfristen im Fall eines Abbruchs oder einer Einschränkung der Geschäftsbeziehung.