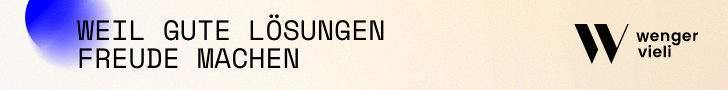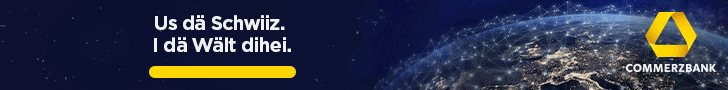Warum gibt es so viele Fehlbesetzungen in den obersten Führungsrängen?
HÜFFER: Oft ist es eine Ausnahme- bzw. Krisensituation, man macht das nicht jeden Tag. In der Hektik wird nicht gründlich oder gar nicht erhoben, was man vom Neuen tatsächlich erwartet. Man tut sich schwer, das auf den Punkt zu bringen. Die grösste Herausforderung ist, ob man kulturell zusammenpasst. Das geht am häufigsten schief.
Ein verlässliches Beurteilungssystem zwischen den strategischen Anforderungen eines Unternehmens und den konkreten Fähigkeiten der Manager fehlt meistens. Viele glauben dann auch noch, fehlende Bezüge mit dem «Bauchgefühl» ersetzen zu können. Wissen aus dem Bauch, nicht aus dem Buch. Aber solche Bauchweisheit, die so wunderbar plausibel klingt, die bringt uns gerade auf diesem Gebiet nicht weiter. Heute arbeitet man zwar intensiver an einer Berufung oder Beförderung als früher – der Ball geht trotzdem oft schon im Auftragsbriefing verloren.
Wie wichtig ist es für Sie, die Anforderungen des rekrutierenden Unternehmens genau zu kennen?
HÜFFER: Die Anforderungen der rekrutierenden Partei festzustellen ist der erste grosse Schritt zum Erfolg. Oft tut sich die rekrutierende Partei zwar nicht leicht, die Anforderungen zu formulieren. Es ist die Aufgabe des Beraters, gut nachzufragen und die tatsächlichen Erwartungen an die oder den Neuen zutage zu fördern. Es ist auch wichtig, kurz anzusprechen, was dem Vorgänger nicht so ganz gelungen ist, so dass man nicht dem Wiederholungszwang verfällt und die Fehler nochmals macht.
Geben Sie etwas auf Mitarbeiter- oder Kundenbewertungen im Internet?
HÜFFER: Nein, das ist eine zu unsichere Datenquelle. Man sollte sehen, dass die Verantwortung für die Berufung der obersten Führungskräfte nicht in den Händen der Mitarbeiter liegt, sondern bei den Gremien – diese Gremien tragen die Verantwortung. Wenn man als Mitglied eines Gremiums eine gewisse Bodenständigkeit hat, dann wird man sich anhören, was die Mitarbeiter zu sagen haben, auch wenn die Perspektive der Mitarbeiter – im Hinblick auf eine oberste Führungskraft – nur eine Teilperspektive ist.
Neben den Medien glauben heutzutage auch Kunden, Aktionäre oder andere Stakeholder, bei der Berufungspolitik mitreden zu müssen. Das ist nicht zuletzt Ausdruck einer zu geringen Verantwortungsübernahme für richtig gute Entscheidungen in manchen Gremien.
Wie erspüren Sie das «Atmosphärische» eines Arbeitgebers – oder, mit anderen Worten, wer von den beiden Protagonisten vernebelte sein wahres Gesicht, wenn eine Fehlbesetzung erfolgte?
HÜFFER: Man kann sagen, dass das, was uns als «Atmosphärisches» bekannt ist, die ungeschriebenen Gesetze sind. Ich komme in ein neues Umfeld, da gibt es geschriebene und ungeschriebene Regeln. Ich übertrete diese und rühre an ein Tabu. Man muss im Vorfeld erkunden, was die Tabuthemen sind, was in dieser sozialen Gruppe akzeptabel und was inakzeptabel ist. Aber auch hier fehlen so manchem die Worte. Es fällt schwer, über Selbstverständliches zu reden.
Auch die Geheimniskrämerei hat hieran ihren Anteil. Die rekrutierende Partei zum Beispiel möchte nicht, dass die Karten offen auf den Tisch kommen. Man glaubt, nicht über alle Dinge öffentlich sprechen zu können. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die an der Anstellung interessierte Partei nicht bereit, offen über eigene Begrenzungen zu sprechen. Beides sind Vorenthaltungen. Wenn die zu gross sind, kann es passieren, dass sich zwei finden, die nicht zueinander gehören. Deshalb ist es die Aufgabe einer guten Beratung, beide Parteien dazu zu bringen, auf pragmatische Weise zum Ausdruck zu bringen, was man voneinander erwartet.
Scheitern mehr Manager an Humankapital im direkten Arbeitsumfeld oder an den eigenen (mangelnden) faktischen Qualitäten?
HÜFFER: Das eine gibt das andere. Die Wahrheit über Fehlbesetzungen – gerade im Top Management – ist, dass derjenige, der da ausgewählt wurde die Ergebnisse nicht bringt. Das wird dann oft mit «atmosphärischen» Problemen bemäntelt, man sagt «man habe sich nicht recht verstanden», die «persönliche Chemie» hätte letzten Endes nicht gestimmt. Doch die Wahrheit ist, dass die Ergebnisse nicht erreicht wurden. Darüber kann man ja schlecht reden. Die Gegenprobe zeigt’s: Oft behält man jemanden an Bord, dessen Ergebnisse gut sind, auch wenn er im zwischenmenschlichen Umgang eklatante, «unsägliche» Mängel aufweist.
Es gibt auch den Fall, dass Manager, die hochgradig fähig sind, hervorragende Leistungen zu erbringen, dies systematisch auf Kosten der Mitarbeiter tun. Ihre rüde, rüpelhafte Art und Weise, mit Menschen umzugehen, ist Teil ihrer Erfolgssystematik. Das kann zum Imageproblem werden, man schämt sich dieser Führungskräfte. Spätestens dann, wenn derartige Experten in dieser Weise gegenüber einem Grossen und Mächtigen ins falsche Horn blasen, gibt’s die «rote Karte». Majestätsbeleidigung fällt mehr ins Gewicht, als die Mitarbeiter zu drangsalieren. Aber viele «kalte Fische» sind zu den Entscheidern sehr zuvorkommend und so wird manches Problem nie sichtbar.
Gibt es Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz?
HÜFFER: Eine Frage der Entfernung. Wenn ich in Amerika oder Asien sitze, dann werde ich sagen, die Länder seien sich ähnlich. Innereuropäisch betrachtet, gibt es selbstverständlich Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz.
Die deutschen Manager sind im Schnitt sachorientierter als die Schweizer. Selbst die Deutschschweizer tragen mindestens zu einem Drittel ein Stück lateinische Mentalität in sich. Eine gewisse Freundlichkeit oder Einfühlsamkeit gehört hier einfach dazu. Der Deutsche hat nicht die gleiche demokratische Luft eingeatmet, wie sie der Schweizer seit Jahrhunderten kennt.
Mal ehrlich, beinahe jeder Nicht-Schweizer ist weniger Widerspruch gewohnt – sehen wir vielleicht mal von Holländern oder Norwegern ab. In der Schweiz haben wir eine Kultur des hierarchieübergreifenden Meinungsaustausches. Das heisst, es wird vom Mitarbeiter in der Regel erwartet, einen eigenständigen Beitrag zu leisten. Der grösste Unterschied ist sicher die Sprache. Wenn jemand zu uns kommt und weder Mundart spricht noch ihn versteht, wird es ihm allemal ein bisschen rätselhaft bleiben wie die Schweiz «tickt».
Sind Unternehmen lernfähig oder wechseln Sie eher den Personalberater? Ertragen es Unternehmen, wenn Sie, als Personalfachmann, sagen: Ihr gesuchtes Profil entspricht nicht dem Managerprofil auf dem Markt?
HÜFFER: Das kommt drauf an. Es gibt Unternehmen, die lassen sich gerne beraten und sich Ideen bringen. Die wissen, wie man einen Dienstleister zum Arbeiten bringt. Es kommt auch darauf an, wie stark der Meinungsbildungsprozess im Hinblick auf das Recruiting fortgeschritten ist. Insgesamt würde ich sagen, dass die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Berater davon lebt, dass man komplementär zueinander ist, dass das in Ordnung ist und man versucht, gemeinsam das Beste zu erreichen. Wer sich aber nicht beraten lässt, dem kann sowieso nicht geholfen werden.
Kann ein Spitzenmanager eines börsenkotierten Unternehmens auch erfolgreicher KMU-Manager sein? Woran könnte so etwas scheitern?
HÜFFER: Es gibt bedeutende kulturelle Unterschiede zwischen verschiedenen Betriebsgrössen. In einem mittelständischen Unternehmen mit 60 oder 100 Mitarbeitern kennt man sich oft persönlich. Gelangt man über die Grenze von 120 Personen, ist es eine echte Hierarchie und in der Hierarchie kennt nicht mehr jeder jeden.
Eine börsenkotierte Unternehmung schafft eine andere kulturelle Realität. Was das Management tut, muss einem völlig aussenstehenden, persönlich nicht bekannten Analysten einleuchten. Die unpopulären Themen müssen zum Teil viel stärker gegen die eigenen Mitarbeiter durchgesetzt werden. Das wäre im KMU in dieser Weise gar nicht möglich, man steht sich persönlich näher.
Wir haben hier zwei ganz bestimmte Kulturen. Das Grossunternehmen steht für die Kultur des anonymisierten Kapitals, in der es keinen persönlich fasslichen Eigentümer gibt, keinen Chef oder keine Chefin in Gestalt einer bestimmten Person. Auf der anderen Seite haben wir die Realität, dass gerade im KMU – in kleinen und mittleren Unternehmen – die persönlichen Beziehungen oft qualitativer sind. Da die meisten Unternehmen in Deutschland und der Schweiz Mittelständler, also KMU sind, gilt das für mehr als 90 Prozent aller Unternehmen. Wir haben also, kulturell gesehen, eine Präferenz für die mittelständische Kultur, die wir so auch vom Grossunternehmen erwarten. Das ist in anderen Ländern völlig anders, zum Beispiel schon in Frankreich. «Le Mittelstand» gibt es kaum.
Ich kann aber sagen, dass es Manager gibt, die ein sehr gutes Gespür dafür haben unter welchen Rahmenbedingungen sie tätig sind. Die können sowohl Mittelstand wie börsenkotiert. Die bringen vielleicht sogar «das Beste aus zwei Welten» zusammen. Dahin geht übrigens auch der Trend.
Wem, beziehungsweise welchem Kandidaten würden Sie den ersten Preis für Schauspiel und Täuschungskunst verleihen? Wie hat er versucht, Sie zu täuschen? Wie können Sie egomane Tendenzen herausfiltern? Wer passt zu wem?
HÜFFER: Es gibt Unternehmenskulturen, in denen Manager bestimmte Typen oder Rollen verkörpern – zum Beispiel in Italien oder in den USA. Gerade deutschsprachige Menschen können das dann als künstlich empfinden. Sie haben den Eindruck einer Scheindarstellung. Das passt nicht zur ernsthaften Wesensart, ganz egal ob das jetzt in Deutschland oder in der Schweiz der Fall ist. Die Österreicher wissen hingegen, dass vieles «Comedy» ist. Das amüsiert sie eher, als dass es sie ärgert.
Ich denke zurück an einen Manager, der im Rollenspiel perfekt die Erwartungen und Anforderungen die man an ihn hatte, verkörperte. Von dem man aber – aufgrund von Referenzen – genau wusste, dass sein konkretes Verhalten sich im Alltag um 180° unterschied von dem was er im Assessment brachte, also «aussen hui und innen pfui». Egomane Tendenzen sind derzeit ausgesprochen verschrien.
Wir sollten aber nicht vergessen, dass ohne eine gewisse Besessenheit, ohne Gewinnstreben oder Ehrgeiz keine Volkswirtschaft zu betreiben ist – nicht einmal eine Planwirtschaft. Erfolg hat irgendwo auch mit Ungleichheit zu tun. Nimmt man nur noch Leute mit egalitären Wertvorstellungen, die auf die Gleichheit der Menschen abzielen, dann hat man keine Wettbewerbswirtschaft mehr, sondern wäre schon im gemein-wirtschaftlichen Modell angekommen. Ich finde zum Beispiel Genossenschaftsunternehmen einen cleveren Mittelweg. Obwohl das Ausschalten der Konkurrenz auch dort eine gefährliche Gemütlichkeit erzeugen kann.
(Bildquelle: © CustomFoto/iStockphoto)