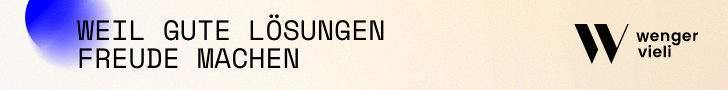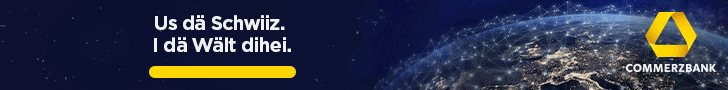Dem Einsatz eines Überwachungs- oder Kontrollsystems durch den Arbeitgeber muss jedoch ein bewusster und sorgfältig abgewogener Entscheid vorausgegangen sein. Andernfalls können die Überwachungsmassnahmen unzulässig sein. Nachfolgend werden die rechtlichen Grundsätze bei der Überwachung am Arbeitsplatz erläutert.

Überwachung am Arbeitsplatz
Die Digitalisierung hat längst den Arbeitsplatz erreicht. Für Arbeitgeber ist es mittlerweile sehr einfach und günstig geworden, Arbeitnehmer am Arbeitsplatz zu überwachen.
Entgegenstehende Interessen
Bei der Überwachung des Arbeitnehmers am Arbeitsplatz kollidieren zwei berechtigte Interessen: Zum einen hat der Arbeitnehmer ein Recht auf den Schutz seiner Persönlichkeit und der persönlichen Integrität (im Sinne der Privatsphäre). Zum anderen hat der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse an und ein Recht auf Überprüfung der Arbeitnehmer in Bezug auf die Ausführung der ihnen übertragenen Arbeiten. Vor Einsatz eines Überwachungssystems müssen diese beiden Interessen gegeneinander abgewogen werden.
Überwiegendes Interesse des Arbeitgebers
Gemäss Gesetz dürfen Überwachungs- und Kontrollsysteme, die das Verhalten der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz überwachen sollen, nicht eingesetzt werden (Art. 26 Abs. 1 der Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz, ArGV3). Sind Überwachungs- und Kontrollsysteme aus anderen Gründen erforderlich, sind sie zulässig, jedoch so zu gestalten und anzuordnen, dass die Gesundheit und die Bewegungsfreiheit der Arbeitnehmer dadurch nicht beeinträchtigt wird (Art. 26 Abs. 2 ArGV3). Überwachungssysteme dürfen somit nicht dazu verwendet werden, die Arbeitnehmer selber (zum Beispiel generelles Verhalten am Arbeitsplatz, soziale Interaktionen etc.) zu überwachen. Der Einsatz von Überwachungssystemen setzt somit einen bestimmten Zweck voraus: Anerkannt ist, dass der Einsatz von Überwachungssystemen zur Überwachung von Produktionsabläufen, aus Sicherheitsgründen aber auch für die Leistungsüberwachung notwendig und somit gerechtfertigt sein kann. Eine zulässige Leistungsüberwachung kann dabei kaum je eindeutig von einer unerlaubten Verhaltensüberwachung unterschieden werden. Die Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen der (zulässigen) Datenerhebung zur Leistungsüberwachung von der (unzulässigen) Datenerhebung zur Verhaltensüberwachung werden in Anbetracht der immer einfacher zu sammelnden und vor allem auch auszuwertenden Datenvolumina zunehmen. Man stelle sich nur ein Unternehmen vor, in welchem die Mitarbeiterbadges mit GPS-Sendern (oder anderen Kommunikationssendern) ausgestattet sind (was jedes geschäftliche Smartphone ohnehin bereits ab Werk hat). Mittels Standortbestimmung kann der Arbeitgeber zum Beispiel feststellen, welche Mitarbeiter jeweils wie lange miteinander Zeit verbringen. Werden die Arbeitnehmer aufgrund dieser Auswertungen getadelt, weil sie zu lange miteinander schwatzen, wäre dies eine klar unzulässige Verhaltensüberwachung. Bezweckt der Arbeitgeber aber die Analyse der Kommunikationsströme für die Optimierung des Kommunikationsverhaltens im Unternehmen, könnte es sich um eine zulässige Leistungsüberwachung handeln. Daher ist beim Einsatz von HR-Analysetools Vorsicht geboten.
Die Frage, was mit der Überwachung bezweckt werden soll, ist somit von zentraler Bedeutung. Das Interesse des Betriebs an der Überwachung muss gegenüber dem Interesse des Arbeitnehmers am Schutz seiner Privatsphäre klar überwiegen. Als Beispiel für ein überwiegendes Interesse gilt die Videoüberwachung im Tresorraum einer Bank.
Die Frage, was mit der Überwachung bezweckt werden soll, ist somit von zentraler Bedeutung. Das Interesse des Betriebs an der Überwachung muss gegenüber dem Interesse des Arbeitnehmers am Schutz seiner Privatsphäre klar überwiegen. Als Beispiel für ein überwiegendes Interesse gilt die Videoüberwachung im Tresorraum einer Bank.
Verhältnismässigkeit beachten
Werden Überwachungssysteme eingesetzt (weil eben ein überwiegendes Interesse des Arbeitgebers daran besteht), dürfen sie nur so eingesetzt werden, dass der Persönlichkeitsschutz und der Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer so weit wie möglich gewahrt bleiben. Es muss somit dasjenige Überwachungsmittel mit der geringsten Beeinträchtigung für den Arbeitnehmer gewählt werden, mit dem das Überwachungsziel (z. B. die Produktionsüberwachung) gerade noch erreicht werden kann. Hierzu kommt es auf die konkreten Umstände und den angestrebten Überwachungszweck an. Soll beispielsweise der Zugang zu einem bestimmten Raum überwacht werden, ist ein Badgesystem einer permanenten Videoüberwachung des Zugangsbereichs vorzuziehen. Ist der Einsatz einer Videokamera unumgänglich, ist sie so zu positionieren, dass praktisch ausschliesslich das überwachte Gut (bei einer Produktionsüberwachung beispielsweise das Förderband) erfasst wird und das Personal nur ausnahmsweise. In diesem Zusammenhang wird generell empfohlen, Kameras im Rücken der Mitarbeiter zu positionieren. Weiter ist zu überlegen, ob die Überwachungsmassnahme ständig aktiviert sein muss. Es ist beispielsweise zulässig, den Fahrweg von Firmenfahr-zeugen zur ökonomischen Optimierung der Strecken zu erfassen und auszuwerten. Sofern ein Arbeitnehmer das Fahrzeug aber auch privat nutzen darf, ist die Wegaufzeichnung während der Freizeit zu deaktivieren.
Die getroffenen Massnahmen sind regelmässig daraufhin zu prüfen, ob das betriebliche Bedürfnis an der Überwachungsmassnahme weiterhin gegeben ist und somit, ob die Massnahme den gesetzlichen Vorgaben nach wie vor entspricht.
Die getroffenen Massnahmen sind regelmässig daraufhin zu prüfen, ob das betriebliche Bedürfnis an der Überwachungsmassnahme weiterhin gegeben ist und somit, ob die Massnahme den gesetzlichen Vorgaben nach wie vor entspricht.
Mitwirkung der Arbeitnehmer
Sollen Überwachungs- und Kontrollsysteme eingesetzt werden, die neben ihrem eigentlichen Zweck auch noch für die Überwachung der Arbeitnehmer verwendet werden können, haben die Arbeitnehmer Anspruch auf vorgängige Information und Anhörung in Bezug auf die einzuführende Massnahme. Bei Videoüberwachung dürfte das regelmässig der Fall sein. Der Arbeitgeber hat dabei in Bezug auf Fragen des Gesundheitsschutzes die Nichtberücksichtigung eines Einwands eines Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmervertretung zu begründen. Eine sorgfältige (und dokumentierte) Vorbereitung der Einführung der Überwachungsmassnahme erleichtert dem Arbeitgeber dabei die Begründung seines Entscheids.
Die Erhebung, Speicherung und Auswertung der gesammelten Daten stellt eine Datenbearbeitung im Sinne des Datenschutzgesetzes dar und hat im Einklang mit den entsprechenden Grundsätzen zu erfolgen. So hat die Bearbeitung der Personendaten für die betroffenen Personen stets auf transparente Art und Weise zu erfolgen. Die betroffenen Arbeitnehmer müssen vorgängig über Art, Ziel und Zweck der Bearbeitung informiert werden. Dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit geschäftlichen EDV-Anlagen, sprich der Benutzung von geschäftlichen E-Mail-Accounts. Es wird dringend empfohlen, die Nutzung geschäftlicher E-Mails und des Internets in einem Reglement zu regeln. Dies erlaubt dem Arbeitgeber, die Rechte und Pflichten des Arbeitnehmers im Zusammenhang mit der Nutzung des E-Mail-Accounts festzulegen und auch die Überwachungs-mechanismen zur Einhaltung dieser Vorgaben zu definieren.
Die Erhebung, Speicherung und Auswertung der gesammelten Daten stellt eine Datenbearbeitung im Sinne des Datenschutzgesetzes dar und hat im Einklang mit den entsprechenden Grundsätzen zu erfolgen. So hat die Bearbeitung der Personendaten für die betroffenen Personen stets auf transparente Art und Weise zu erfolgen. Die betroffenen Arbeitnehmer müssen vorgängig über Art, Ziel und Zweck der Bearbeitung informiert werden. Dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit geschäftlichen EDV-Anlagen, sprich der Benutzung von geschäftlichen E-Mail-Accounts. Es wird dringend empfohlen, die Nutzung geschäftlicher E-Mails und des Internets in einem Reglement zu regeln. Dies erlaubt dem Arbeitgeber, die Rechte und Pflichten des Arbeitnehmers im Zusammenhang mit der Nutzung des E-Mail-Accounts festzulegen und auch die Überwachungs-mechanismen zur Einhaltung dieser Vorgaben zu definieren.
Folgen einer unzulässigen Überwachung
Die Überwachung von Arbeitnehmern ohne Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen kann weitereichende, ja sogar strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
Die Überwachung von Arbeitnehmern ohne Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben stellt zunächst eine Verletzung des Arbeitsgesetzes dar, insbesondere Art. 26 ArGV3. Das bedeutet, dass ein Arbeitsinspektor diesen Verstoss feststellen und ahnden kann. Wer unzulässige Überwachungsmassnahmen einsetzt, macht sich zudem auch angreifbar für anonyme Anzeigen vergrämter Arbeitnehmer. Der Arbeitsinspektor kann sodann Einsicht in sämtliche Unterlagen und Daten der betriebenen Kontroll- und Überwachungs-systeme verlangen.
Der unzulässige Einsatz eines Überwachungs- und Kontrollsystems stellt im Verhältnis zu den Arbeitnehmern eine Persönlichkeitsverletzung und somit eine Verletzung der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers dar. Der Arbeitnehmer hat für die Persönlichkeitsverletzung Anspruch auf Genugtuung. Die Höhe der zugesprochenen Genugtuungssummen ist in der Regel von untergeordneter Bedeutung. Jedoch kann die unzulässige Überwachung einen begründeten Anlass für die Kündigung eines Arbeitnehmers darstellen, womit ein allfälliges nachvertragliches Konkurrenz-verbot trotz Kündigung des Arbeitnehmers wegfallen könnte.
Die Aufnahme fremder Gespräche ohne Einwilligung der betroffenen Person kann zudem einen Verstoss gegen Art. 179bis des Strafgesetzbuches (StGB) darstellen, was mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft werden kann. Das Anfertigen von Videoaufnahmen ohne Einwilligung der betroffenen Personen kann gemäss Art. 179quater StGB mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe bestraft werden. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass überwachte Bereiche klar als solche gekennzeichnet sind.
Werden Beweismittel durch unzulässige Überwachungsmittel beschafft, droht deren prozessuale Unverwertbarkeit. Das bedeutet, dass diese Beweismittel in einem Gerichtsverfahren nicht beachtet werden dürfen. Werden beispielsweise die E-Mails eines Arbeitnehmers ohne Beachtung der dafür notwendigen rechtlichen Voraussetzungen überwacht, kann deren Inhalt in einem Prozess gegen den Mitarbeiter nicht verwendet werden.
Die Überwachung von Arbeitnehmern ohne Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben stellt zunächst eine Verletzung des Arbeitsgesetzes dar, insbesondere Art. 26 ArGV3. Das bedeutet, dass ein Arbeitsinspektor diesen Verstoss feststellen und ahnden kann. Wer unzulässige Überwachungsmassnahmen einsetzt, macht sich zudem auch angreifbar für anonyme Anzeigen vergrämter Arbeitnehmer. Der Arbeitsinspektor kann sodann Einsicht in sämtliche Unterlagen und Daten der betriebenen Kontroll- und Überwachungs-systeme verlangen.
Der unzulässige Einsatz eines Überwachungs- und Kontrollsystems stellt im Verhältnis zu den Arbeitnehmern eine Persönlichkeitsverletzung und somit eine Verletzung der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers dar. Der Arbeitnehmer hat für die Persönlichkeitsverletzung Anspruch auf Genugtuung. Die Höhe der zugesprochenen Genugtuungssummen ist in der Regel von untergeordneter Bedeutung. Jedoch kann die unzulässige Überwachung einen begründeten Anlass für die Kündigung eines Arbeitnehmers darstellen, womit ein allfälliges nachvertragliches Konkurrenz-verbot trotz Kündigung des Arbeitnehmers wegfallen könnte.
Die Aufnahme fremder Gespräche ohne Einwilligung der betroffenen Person kann zudem einen Verstoss gegen Art. 179bis des Strafgesetzbuches (StGB) darstellen, was mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft werden kann. Das Anfertigen von Videoaufnahmen ohne Einwilligung der betroffenen Personen kann gemäss Art. 179quater StGB mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe bestraft werden. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass überwachte Bereiche klar als solche gekennzeichnet sind.
Werden Beweismittel durch unzulässige Überwachungsmittel beschafft, droht deren prozessuale Unverwertbarkeit. Das bedeutet, dass diese Beweismittel in einem Gerichtsverfahren nicht beachtet werden dürfen. Werden beispielsweise die E-Mails eines Arbeitnehmers ohne Beachtung der dafür notwendigen rechtlichen Voraussetzungen überwacht, kann deren Inhalt in einem Prozess gegen den Mitarbeiter nicht verwendet werden.
Empfehlungen
- Vor Einführung eines Überwachungs- und Kontrollsystems ist eine Bedarfsanalyse durchzuführen. Dabei ist zu fragen, was mit der beabsichtigten Massnahme überwacht bzw. kontrolliert werden soll («Was möchte ich erreichen?»). – Diese Bedarfsanalyse ist regelmässig zu wiederholen.
- Bei der Wahl der Überwachungsmassnahme ist die Verhältnismässigkeit (Zweck-Mittel-Relation) zu wahren («Nur so viel wie nötig»).
- Die Unterlagen zu Wirkungsweise, Art und Zeitpunkt der Aufzeichnung und die allfällige Bedarfsanalyse sind aufzubewahren.
- Sofern die Überwachungsmassnahme auch das Verhalten der Arbeitnehmer erfassen kann, sind die Mitarbeiter vorgängig anzuhören. Dies ist zu protokollieren.
- Für geschäftliche E-Mail-Accounts und die Internetnutzung ist ein Reglement zu erlassen, welches die Rechte und Pflichten des Arbeitnehmers und die Kontrollmöglichkeiten des Arbeitgebers regelt.